Zusammenfassung
Antibiotika sind Substanzen, die eine hemmende Wirkung auf den Stoffwechsel von Mikroorganismen haben und sie so an ihrer Vermehrung oder ihrem Überleben hindern.
Im Gegensatz zu den eukaryotischen Zellen des menschlichen Körpers sind Bakterien prokaryotisch, das heißt, sie sind primitive einzellige Organismen. Diese Unterschiede in der Zellstruktur ermöglichen es Antibiotika, gezielt auf Bakterien zu wirken, ohne die menschlichen Zellen zu beeinträchtigen.
Antibiotika können je nach ihrer Wirkungsweise in zwei Kategorien eingeteilt werden:
- Bakterizide Antibiotika: Diese Antibiotika sind in der Lage, Bakterien direkt abzutöten. Sie greifen die bakterielle Zellwand oder die DNA
an und führen zu einer irreversiblen Schädigung der Bakterienzellen - Bakteriostatische Antibiotika: Diese Antibiotika hemmen das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien, indem sie bestimmte Stellen des bakteriellen Stoffwechsels beeinflussen und so die Vermehrung der Bakterien verlangsamen oder stoppen. Sie töten die Bakterien nicht unbedingt ab, sondern erleichtern es dem körpereigenen Immunsystem, die verbleibenden Bakterien zu bekämpfen
Übersicht


Allgemeine Nebenwirkungen
- Allergien: β-Lactam-Antibiotika
- Kardiotoxizität: Makrolide, Fluorchinolone
- Hepatotoxizität: Ansamycine, Isoniazid
- Nephrotoxizität: Aminoglykoside, Glykopeptide
- Gastrointestinale(GI)-Störungen: häufig durch Störung der Darmbakterien
- Exantheme: Aminopenicilline, Tetrazykline, Makrolide, Sulfonamide
- Störungen der Blutbildung: Folsäureantagonisten, Linezolid, Chloramphenicol
- Zahn-, Knorpel- und Knochendestruktion, Tendopathien: Fluorchinolone, Tetrazykline
Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft können bestimmte Antibiotika das ungeborene Kind gefährden. Aus diesem Grund sollte der Einsatz von Antibiotika auf das notwendige Minimum beschränkt werden und nur dann erfolgen, wenn es für die Gesundheit der Mutter oder des Kindes unbedingt erforderlich ist. Ausführliche Informationen zur Arzneimittelsicherheit in der Schwangerschaft und Stillzeit
Bewährte Wirkstoffe (bevorzugt verwenden):
- Penicilline (Amoxicillin, Ampicillin, Penicillin V, etc.)
- Cephalosporine
- Erythromycin und Azithromycin (Makrolide)
Zellwandsyntheseinhibitoren: β-Lactam-Antibiotika
β-Lactam-Antibiotika gehören zu den am häufigsten eingesetzten Antibiotikaklassen und haben eine Wirksamkeit bei einer Vielzahl von bakteriellen Infektionen. Sie wirken durch eine Hemmung der bakteriellen Zellwandsynthese, indem sie an das Enzym Transpeptidase (Penicillin-bindendes Protein/PBP) binden und somit die Quervernetzung von Peptidoglykanen in der Bakterienzellwand verhindern. Sie besitzen eine große therapeutische Breite
MerkeZu den β-Lactam-Antibiotika gehören:
- Penicilline
- Cephalosporine
- Carbapeneme
- Monobactame

Resistenzmechanismen
- Primäre Resistenz: keine Wirkung bei zellwandlosen Bakterien
- Sekundäre Resistenz:
- Bakterien können Beta-Lactamase produzieren, ein Enzym, das die Beta-Lactam-Ring-Struktur der Antibiotika spaltet und somit die Wirkung des Antibiotikums neutralisiert → Aufgrund dieses Resistenzmechanismus werden β-Lactam-Antibiotika oft mit β-Lactamase-Inhibitoren (BLI) kombiniert
- Strukturelle Veränderung der Penicillin-Bindeproteine, wodurch diese nicht mehr effektiv vom Antibiotikum gehemmt werden können
Penicilline
Penicilline sind Antibiotika, welche durch Alexander Flemming 1928 entdeckt worden sind. Dieser hatte eine Bakterienkultur verschimmeln lassen und bemerkt, dass die Bakterien in der Nähe des Schimmelpilzes (Penicillium notatum) abgetötet wurden. Diese Entdeckung legte den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Penicilline. Diese lassen sich wie folgt einteilen:
- Schmalspektrumpenicilline:
- Benzylpenicilline/Penicillin G
- Phenoxymethylpenicilline/Penicillin V
- Penicillinasefeste Penicilline/Isoxazolylpenicilline
(Flucloxacillin)
- Breitspektrumpenicilline:
- Aminopenicilline (Amoxicillin, Ampicillin)
- Acylaminopenicilline/Ureidopenicilline (Piperacillin)
- Penicillin + Beta-Lactamase-Inhibitor
Übersicht
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen | |
|---|---|---|---|
| Penicilline Bakterizid | |||
| Klassische Penicilline | Penicillin G = Benzylpenicillin (i.v./i.m.) | V.a. grampositive
|
|
| Penicillin V = Phenoxymethyl-penicillin (p.o.) | |||
| Depot-Penicillin G = Benzathin-Benzylpenicillin | |||
Penicillinase-feste Penicilline (Staphylokokken Isoxazolyl-penicilline | Flucloxacillin | Grampositive
|
|
Oxacillin  | |||
| Amino-penicilline | Amoxicillin | V.a. grampositive
|
|
| Ampicillin (meist i.v.) | |||
| Acylamino-penicilline | Piperacillin | Grampositive Gramnegative inklusive Pseudomonas
|
|
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen | |
|---|---|---|---|
ß-Lactamase-Inhibitoren (BLI) Keine eigene antibakterielle Wirkung bei ß-Lactamase-bildenden Erregern | |||
| Aminopenicilline + BLI | Sulbactam + Ampicillin | Grampositive Gramnegative |
|
| Clavulansäure + Amoxicillin | |||
| Acylamino-penicilline + BLI | Tazobactam + Piperacillin | Grampositive Gramnegative inklusive Pseudomonas |
|
Nebenwirkungen
- Allergische Reaktion (Penicillin-Allergie)
- Neurotoxizität bei hohen Dosen
- Jarisch-Herxheimer-Reaktion im Rahmen einer Lues-Therapie
→ Entzündungsreaktion durch massiven Erregerzerfall - Aminopenicilline:
- Arzneimittelexanthem
→ Bei Antibiotikagabe bei infektiöser Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber), welche durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) ausgelöst wird - Allergie
- Durchfall
- Arzneimittelexanthem

James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
MerkePenicilline
→ Meist gut verträglich, große therapeutische Breite
, interagieren kaum mit menschlichen Enzymen; kaum relevante Interaktionen mit anderen Arzneimitteln!
Kontraindikationen
- Penicillin-Allergie
- Schwere Niereninsuffizienz
- Infektiöse Mononukleose
Cephalosporine
Cephalosporine sind eine Gruppe von Beta-Lactam-Antibiotika, die strukturell mit den Penicillinen verwandt sind. Sie besitzen ein breites Spektrum im grampositiven und gramnegativen Bereich.
AchtungGegen die folgenden Erreger sind Cephalosporine nicht wirksam:
- Atypische Erreger wie Mykoplasmen
, Chlamydien oder Legionellen - Enterokokken (Enterococcus faecium und E. faecalis) → Enterokokkenlücke
- Listerien → Listerienlücke
- Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus
(MRSA)
Ausnahme: 5. Generation (Ceftarolin)- Clostridium difficile
TippUm die Listerienlücke zu schließen, werden Cephalosporine z. B. bei der kalkulierten Therapie der bakteriellen Meningitis mit Ampicillin kombiniert!
Übersicht
Die Cephalosporine werden abhängig von ihrem Wirkspektrum in fünf Generationen eingeteilt.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen | ||
|---|---|---|---|---|
Cephalosporine Bakterizid | ||||
| 1. Generation | Cefazolin (i.v.) | V.a. grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien Clostridium difficile) |
| |
| Cefalexin (p.o.) | ||||
| 2. Generation | Cefuroxim/ Cefuroximaxetil (i.v./p.o.) Cefaclor | Sehr breites Spektrum (bessere Stabilität gegenüber V.a. grampositive
Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien Clostridium difficile) Viele gramnegative
|
| |
| 3. Generation (3a) | Cefotaxim (i.v.) | |||
Ceftriaxon (i.v.)
| ||||
| 3. Generation (3b) | Ceftazidim (i.v.) | Wenige grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke Viele gramnegative inklusive Pseudomonas |
| |
| 4. Generation | Cefepim (i.v.) | Grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien Clostridium difficile) Viele gramnegative inklusive Pseudomonas |
| |
| 5. Generation (5a) | Ceftarolin (i.v.) | Grampositive Aber Listerienlücke und Enterokokkenlücke (unwirksam bei Legionellen, Chlamydien Clostridium difficile) Multiresistente: MRSA, VRE Viele gramnegative |
| |
| 5. Generation (5b) | Ceftobiprol | |||
Nebenwirkungen
- Kreuzallergie bei Penicillin-Allergie
- Alkoholintoleranz
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
- Erhöhte Blutungsneigung (Hemmung der Synthese von Vitamin-K
-abhängigen Gerinnungsfaktoren)
MerkeCephalosporine
→ Große therapeutische Breite
: interagieren kaum mit menschlichen Enzymen; kaum relevante Interaktionen mit anderen Arzneimitteln
→ Cephalosporine erhöhen die Gefahr einer Infektionmit Clostridium difficile
Kontraindikationen
- Penicillin-Allergie
- Schwere Niereninsuffizienz
Carbapeneme
Carbapeneme sind eine Klasse von Beta-Lactam-Antibiotika, die gegen ein breites Spektrum von Bakterien wirksam sind. Sie gehören zu den Reserveantibiotika bei schweren bakteriellen Infektionen, insbesondere bei multiresistenten Erregern. Carbapeneme haben eine bakterizide Wirkung. Sie werden intravenös verabreicht und haben eine gute Gewebegängigkeit. Es ist wichtig, ihren Einsatz aufgrund der zunehmenden Entwicklung von Carbapenem-resistenten Bakterien auf ein Minimum zu beschränken und sie nur dann einzusetzen, wenn andere Antibiotika nicht wirksam sind.
Übersicht
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Carbapeneme Bakterizid | ||
| Imipenem | Grampositive MRSA Viele gramnegative z.T. auch ESBL/3-MRGN Inklusive Pseudomonas Wirklücke bei atypischen Erregern wie Mykoplasmen |
|
| Meropenem | ||
| Ertapenem | ||
Nebenwirkungen
- Neurotoxizität
- Allergische Reaktionen
- Sekundärinfektionen (orale Candidose, Pilzinfektionen der Vulva)
Kontraindikationen
- Penicillin-Allergie
- Schwere Niereninsuffizienz
- Schwangerschaft, Stillzeit
Monobactame
Monobactame sind ausschließlich gegen aerobe gramnegative Bakterien wirksam. Sie enthalten nur einen Beta-Lactam-Ring, im Gegensatz zu den anderen Beta-Lactam-Antibiotika (Penicilline, Cephalosporine oder Carbapeneme), die mindestens zwei aneinander hängende Ringstrukturen enthalten. Dadurch rufen sie weniger allergische Reaktionen hervor. Der wichtigste Vertreter dieser Gruppe ist Aztreonam, das auch als Reserveantibiotikum eingesetzt wird.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
Monobactame Bakterizid | ||
| Aztreonam | Nur gramnegative Pseudomonas |
|
Nebenwirkungen
- Husten
- Verstopfte Nase
- Pfeifendes Atemgeräusch
Kontraindikationen
- Kreuzallergie bei Ceftazidim-Allergie aufgrund identischer Seitenkette
Weitere Zellwandsynthese-Inhibitoren
Glykopeptide
Glykopeptide sind Reserveantibiotika, die hauptsächlich zur Behandlung von schweren Infektionen durch grampositive Bakterien (Staphylokokken, Enterokokken und Clostridium difficile) eingesetzt werden. Gegenüber gramnegativen Bakterien sind sie wirkungslos, da sie aufgrund ihrer Molekülgröße die äußere Zellwand der gramnegativen Bakterien nicht durchdringen können. Die bekanntesten Vertreter der Glykopeptide sind Vancomycin und Teicoplanin, die insbesondere bei Infektionen durch Methicillin-resistente Staphylococcus aureus

| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
Glykopeptide Bakterizid | ||
Vancomycin Teicoplanin (meist bakterizid und teilweise bakteriostatisch) | Nur grampositive MRSA |
|
TippGlykopeptide werden schlecht resorbiert und müssen daher in der Regel intravenös verabreicht werden! Eine Ausnahme bildet die pseudomembranöse Kolitis
. Hier kann Vancomycin oral verabreicht werden und so den auslösenden Keim Clostridioides difficile gezielt im Darm bekämpfen.
Nebenwirkungen
- Nephrotoxisch
→ Vorsicht bei Kombination mit nephrotoxischen Substanzen(NSAR , Aminoglykoside, Aciclovir etc.) - Ototoxisch
- Vancomycin: Gefahr eines Red-Man-Syndroms bei rascher Infusion (anaphylaktoide Reaktion)
Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
- Schwangerschaft
- Niereninsuffizienz
- Hörschäden
InfoDas Red-Man-Syndrom ist eine seltene Nebenwirkung, die mit der Verabreichung von bestimmten Antibiotika wie Vancomycin in Verbindung steht. Durch eine Histamin-Freisetzung kommt es zu einer auffälligen Rötung der Haut, insbesondere im Gesicht, Nacken und Oberkörper, begleitet von Symptomen wie Juckreiz, Flushing (anfallsweise auftretende Rötung (Erythem)) und selten niedrigem Blutdruck. Durch die Einhaltung empfohlener Dosierungsrichtlinien und eine langsame Infusionsrate kann das Risiko für das Red-Man-Syndrom reduziert werden.
Epoxide
Epoxide sind eine Gruppe von Antibiotika, die durch ihre einzigartige chemische Struktur gekennzeichnet sind. Der wichtigste Vertreter ist das Fosfomycin. Es wirkt durch die Hemmung der Phosphoenolpyruvattransferase, welche ein wichtiges Enzym für die Bildung von N-Acetylmuraminsäure (NAM = Hauptbestandteil der bakteriellen Zellwand) darstellt.

| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Epoxide Bakterizid | ||
| Fosfomycin | Einzelne grampositive MRSA, MSSA Gramnegative |
|
Nebenwirkungen
- Insbesondere gastrointestinale Nebenwirkungen
- Exantheme
- Kopfschmerzen
- Anstieg von Transaminasen
und AP - Blutbildveränderungen
Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
- Niereninsuffizienz (GFR <10 ml/min)
- Hämodialyse
Proteinsyntheseinhibitoren
Das bakterielle Ribosom hat eine etwas andere Struktur als das Ribosom von Eukaryoten, was bedeutet, dass Proteinsyntheseinhibitoren in der Regel selektiver für das bakterielle Ribosom sind und eine geringere Toxizität für eukaryotische Zellen aufweisen. Die Bakterien-Ribosomen
Übersicht

Hemmung der Proteinsynthese (50S-Ribosom)
Makrolide

Makrolide wirken bakteriostatisch, indem sie an die 50S-Untereinheit binden und dadurch die Translokation (also das „Entlanggleiten“ des Ribosoms an der mRNA
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Makrolide Bakteriostatisch | ||
| Clarithromycin | Atypisches Gramverhalten: intrazelluläre Erreger
Einige grampositive
Einige gramnegative
|
|
| Azithromycin | ||
| Roxithromycin | ||
Erythromycin Roxithromycin, Azithromycin und Clarithromycin haben eine günstigere Pharmakokinetik | ||
Nebenwirkungen
- Hepatotoxizität
- QT-Zeit
-Verlängerung - Diarrhö
- CYP3A4
-Inhibition
→ Können bei Kombination mit Phenprocoumon oder Dabigatranden Abbau verzögern und zu einem erhöhten INR und einer erhöhten Blutungsneigung führen
→ Bei Kombination mit Statinen: Gefahr von Rhabdomyolyse und Myopathie - Viele Interaktionen
AchtungAufgrund des ähnlichen Wirkmechanismus von Makroliden und Lincosamiden (Clindamycin) können sie sich gegenseitig abschwächen. Sie sollten deshalb nicht kombiniert werden. Außerdem können partielle Kreuzresistenzen bestehen.
Kontraindikationen
- Makrolid-Allergie
- Schwere Leberinsuffizienz (relativ)
TippMakrolide erhöhen den Serumspiegel von Statinen → Wegen der Gefahr von lebensbedrohlichen Rhabdomyolysen sollte eine Statintherapie während der Makrolidtherapie pausiert werden!
Lincosamide
Lincosamide sind eine Klasse von Antibiotika, deren einziger Vertreter Clindamycin ist. Sie zeichnen sich durch eine gute Gewebe- und Knochengängigkeit aus und werden vor allem als Reserveantibiotika bei Infektionen mit resistenten Staphylokokken und Anaerobiern eingesetzt. Clindamycin wirkt bakteriostatisch, indem es an die 50S-Untereinheit bindet und so die Proteinbiosynthese blockiert. Dadurch wird die Bildung funktionsfähiger Proteine verhindert und das Bakterienwachstum gehemmt.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
Lincosamide Bakteriostatisch | ||
| Clindamycin | Grampositive
|
|
Nebenwirkungen
- Hohes Risiko für pseudomembranöse Kolitis
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
Oxazolidinone

Oxazolidinone sind eine relativ neue Gruppe von Proteinsyntheseinhibitoren. Der einzige Vertreter dieser Gruppe, Linezolid, ist wirksam gegen grampositive Bakterien, einschließlich MRSA, Vancomycin resistente Enterokokken und weitere multiresistente Bakterien. Linezolid ist daher ein Reserveantibiotikum für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch multiresistente Bakterien verursacht werden. Der Wirkmechanismus von Linezolid beruht auf seiner Fähigkeit, an die 50S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms zu binden und die Bildung des Initiationskomplexes der Proteinsynthese zu verhindern.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Oxazolidinone Bakteriostatisch | ||
| Linezolid | Nur grampositive MRSA, VRE, multiresistente Keime |
Reserveantibiotikum für Infektionen durch multiresistente grampositive Erreger |
Nebenwirkungen
- Metallischer Geschmack
- Blutbildveränderungen
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
- Anstieg der alkalischen Phosphatase und Transaminasen
- Vaginale und/oder orale Candidose
- Hypertonie
- Kopfschmerzen
Kontraindikationen
- Keine Kombination mit MAO-Hemmern, SSRIs
, Trizyklika , Triptanen oder Sympathomimetika
→ Hemmung der MAO-A und MAO-B - Schwangerschaft, Stillzeit
Hemmung der Proteinsynthese (30S-Ribosom)
Aminoglykoside

Aminoglykoside sind eine Gruppe von Antibiotika, die vor allem gegen gramnegative Bakterien eingesetzt werden. Aufgrund ihrer geringen oralen Bioverfügbarkeit werden Aminoglykoside meist intravenös oder lokal verwendet. Aminoglykoside wirken bakterizid, indem sie durch Anlagerung an der 30S-Untereinheit Ablesefehler der mRNA und damit fehlerhafte Proteine verursachen.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Aminoglykoside Bakterizid | ||
| Gentamicin | Atypisches Gramverhalten
Eingeschränkt grampositive
Gramnegative inklusive Pseudomonas, E. coli und Klebsiellen |
Um eine möglichst hohe Spitzenkonzentration zu erreichen und die Toxizität zu reduzieren, wird die gesamte Tagesdosis morgens verabreicht! |
| Tobramycin | ||
| Amikacin | ||
| Streptomycin | ||
| Paromomycin | ||
Nebenwirkungen
- Nephrotoxisch
→ Vorsicht bei der Kombination mit Glykopeptiden (Vancomycin), NSAR, Amphotericin B, Furosemid etc. - Neurotoxizität
- Oto-vestibulo-toxisch → Hör- und Gleichgewichtsstörungen
→ Vor Therapiebeginn HNO-ärztliche Mitbeurteilung
Kontraindikationen
- Schwangerschaft, Stillzeit
- Niereninsuffizienz
- Bekannte Hör- und Gleichgewichtsstörungen
AchtungAminoglykoside sollten nicht mit anderen nephrotoxischen Substanzen (Vancomycin, Cisplatin, Ciclosporin, Amphotericin B, etc.) kombiniert werden.
Tetrazykline
Tetrazykline sind eine Klasse von Antibiotika, die seit den 1940er Jahren eingesetzt werden. Sie wirken bakteriostatisch, indem sie an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms binden und so die Anlagerung der tRNA an die mRNA blockieren. Dadurch wird die Proteinbiosynthese und das Bakterienwachstum gehemmt. Tetrazykline haben ein breites Wirkungsspektrum und sind wirksam gegen eine Vielzahl von grampositiven und gramnegativen Bakterien, gegen Spirochäten wie Borrelien und gegen einige intrazelluläre Erreger wie Chlamydien und Rickettsien.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
Tetrazykline Bakteriostatisch | ||
| Doxycyclin | Atypisches Gramverhalten: intrazelluläre Erreger
Grampositive Einzelne gramnegative |
|
Nebenwirkungen
- Nephrotoxisch
- Hepatotoxisch
- Einlagerung in Knochen und Zähne
→ Komplexbildung mit Ca2+-Ionen
→ Keine Einnahme mit Milch! - Schleimhautschäden an Mund- und Rachenschleimhaut
- Photosensibilisierung
Kontraindikationen
- Kinder bis zum 8. Lebensjahr
→ Zahnschäden, Zahnverfärbungen und Wachstumsstörungen - Schwangerschaft, Stillzeit
- Schwere Nieren- und Leberinsuffizienz
Glycylcycline
Glycylcycline sind eine relativ neue Gruppe von Antibiotika, die als Derivate der Tetrazykline entwickelt wurden. Der erste und einzige Vertreterin dieser Wirkstoffgruppe ist Tigecyclin. Glycylcycline haben ein breites Wirkungsspektrum und sind gegen eine Vielzahl von grampositiven und gramnegativen Bakterien wirksam, einschließlich multiresistenter Stämme. Der Wirkmechanismus der Glycylcycline besteht darin, dass sie an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms binden (5-fach höhere Affinität als Tetrazykline) und die Anlagerung der tRNA blockieren. Glycylcycline werden aufgrund ihres breiten Wirkspektrums und der Möglichkeit, auch resistente Infektionen zu behandeln, in bestimmten Fällen als Alternative zu anderen Antibiotika eingesetzt.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Glycylcyclin Bakteriostatisch | ||
| Tigecyclin | Grampositive inklusive MRSA und VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) Gramnegative |
|
Nebenwirkungen
- Hepatotoxizität
- Pankreatitis
- Verdauungsstörungen
Kontraindikationen
- Schwangerschaft, Stillzeit
- Leberinsuffizienz
- Für Jugendliche <18 Jahren nicht empfohlen
Hemmung der Peptidyltransferase
Chloramphenicol

Chloramphenicol ist ein bakteriostatisch wirkendes Breitbandantibiotikum. Es hemmt die bakterielle Proteinbiosynthese, an der 50S-Untereinheit indem es die Peptidyltransferase und damit die Bildung neuer Peptidbindungen blockiert. Chloramphenicol kann sowohl gegen grampositive als auch gramnegative Bakterien und intrazelluläre und zellwandlose Erreger eingesetzt werden. Aufgrund der seltenen, aber potentiell lebensbedrohlichen Nebenwirkung der aplastischen Anämie und hoher Resistenzraten wird Chloramphenicol nur noch selten verwendet.
| Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|
| Chloramphenicol Bakteriostatisch | |
Grampositive Gramnegative |
|
Nebenwirkungen
- Myelotoxisch/Knochenmarkstoxisch
→ Panzytopenie, aplastische Anämie (potentiell lebensbedrohlich, Auftreten mit einer Verzögerung von 2–8 Wochen) - Neurotoxizität (Neuritis nervi optici, etc.)
- Allergische Reaktionen
- Grey-Syndrom: bei Neugeborenen kann es aufgrund einer unzureichenden Glucuronidierung zu einer Akkumulation von Chloramphenicol mit Atemproblemen, Kreislaufversagen und grauer Hautverfärbung kommen
Kontraindikationen
- Schwangerschaft, Stillzeit
- Schwere Leberinsuffizienz
- Erkrankungen des hämatopoetischen Systems
Einfluss auf das Bakterienchromosom
Fluorchinolone (Gyrasehemmer)
Fluorchinolone wirken bakterizid, indem sie die DNA-Synthese in den Bakterienzellen hemmen. Hierfür binden sie an die DNA-Gyrase (Topoisomerase II) oder die Topoisomerase IV, welche für die Entwindung und Reparatur der DNA verantwortlich sind. Dadurch kommt es zu einer Störung der DNA-Replikation und letztendlich zum Absterben des Bakteriums. Fluorchinolone haben ein breites Spektrum an Wirksamkeit gegen grampositive und gramnegative Bakterien und werden daher zur Behandlung von Infektionen der Atemwege, des Harntrakts, der Haut, der Knochen und des Weichteilgewebes eingesetzt. Jedoch sind sie aufgrund möglicher schwerwiegender Nebenwirkungen, wie Sehnenrupturen, Psychosen und lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, mit Vorsicht anzuwenden.
Die Fluorchinolone lassen sich anhand ihres Wirkspektrums in vier Gruppen einteilen:
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| (Fluor)-Chinolone/Gyrasehemmer Bakterizid | ||
Norfloxacin (Gruppe 1) | V.a. gramnegative Stäbchen |
|
Ciprofloxacin (Gruppe 2) | Grampositive
Gramnegative
|
Ciprofloxacin ist aufgrund der UAWs & Interaktionen heutzutage bei unkompliziertem HWI nur noch Mittel der 2. Wahl |
Levofloxacin (Gruppe 3) | Grampositive
Gramnegative
Atypisches Gramverhalten
|
|
Moxifloxacin (Gruppe 4) | Anaerobier Grampositive
Gramnegative
Atypisches Gramverhalten
|
|
Nebenwirkungen
- QT-Zeit-Verlängerung
- Aortenaneurysma oder -dissektion
- Muskuläre Beschwerden, Tendinitis, Sehnenruptur (Achillessehne häufig)
- Keine Einnahme mit Milch (Chelatbildung)
- Neurotoxizität, Senkung der Krampfschwelle
- Hepatotoxizität
- Arthropathien, Knorpelschäden
- Verschlechterung einer Myasthenia gravis möglich
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
- Hyper-/Hypoglykämien
- Phototoxizität/Hautreaktion
- Psychiatrisch: innere Unruhe, wahnhafte Episoden, Schlafstörungen
- Viele Interaktionen
Kontraindikationen
- Schwangerschaft, Stillzeit
- Kinder, Jugendliche
- Krampfleiden (Epilepsie – Fluorchinolone/Gyrasehemmer senken die Krampfschwelle)
- Niereninsuffizienz
- Leberinsuffizienz
- Herzrhythmusstörungen
- Sehnenerkrankungen
AchtungRote-Hand-Briefe
- Risikoerhöhung für: Aortenaneurysmata und –dissektionen sowie für eine Herzklappeninsuffizienz (systemisch oder inhalative Anwendung)
- Schwere anhaltende/irreversible unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) des Bewegungsapparates und des peripheren sowie zentralen Nervensystems
Nitroimidazole
Nitroimidazole sind eine Gruppe antimikrobieller Wirkstoffe, die insbesondere gegen Protozoen und anaerobe Bakterien eingesetzt werden. Der bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist Metronidazol. Metronidazol wirkt auf eine einzigartige Weise, indem es durch die Reduktion von Nitrogruppen zu reaktiven Radikalen führt. Diese Radikale können DNA-Strangbrüche verursachen und dadurch eine bakterizide Wirkung auf Bakterien ausüben.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Nitroimidazole Bakterizid | ||
Metronidazol Bakterizid | Protozoen
Grampositive
Gramnegative |
|
Nebenwirkungen
- Neurotoxizität (Polyneuropathie)
- Alkoholunverträglichkeit
- Gastrointestinale-Störungen
- Metallischer Mundgeschmack
Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
Folsäuresynthese
Sulfonamide und Diaminopyrimidine
Sulfonamide und Diaminopyrimidine sind zwei Klassen von Antibiotika, die zur Gruppe der Folsäureantagonisten gehören. Sulfonamide binden an das Enzym Dihydropteroinsäure-Synthetase und hemmen dadurch die Synthese von Dihydrofolsäure. Diaminopyrimidine hemmen das Enzym Dihydrofolatreduktase, das für die Synthese von Tetrahydrofolsäure benötigt wird. Cotrimoxazol ist eine Kombination aus Sulfamethoxazol, einem Sulfonamid, und Trimethoprim, einem Diaminopyrimidin. Durch die Kombination dieser zwei Wirkstoffe werden zwei aufeinanderfolgende Schritte gehemmt und es ergeben sich synergistische Effekte. Da bereits viele Bakterienstämme resistent gegen diese Antibiotika geworden sind, werden sie oft nur noch als Zweitlinientherapie eingesetzt.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Sulfonamide und Diaminopyrimidine Teilweise bakterizid | ||
Cotrimoxazol = Trimethoprim + Sulfamethoxazol (Dihydrofolat-reduktase-Inhibitoren + Sulfonamide) | Grampositive Enterokokken unwirksam Gramnegative Pseudomonas unwirksam |
|
Nebenwirkungen
- Stevens-Johnson-Syndrom (Maximalform: toxisch epidermale Nekrolyse)
- Exantheme
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
Kontraindikationen
- Allergie gegen Sulfonamide und/oder Trimethoprim
- Schwangerschaft
- Früh- & Neugeborene
InfoDas Stevens-Johnson-Syndrom ist eine schwere, seltene und lebensbedrohliche immunvermittelte Reaktion, die hauptsächlich durch die Anwendung von Medikamenten (Sulfonamide, Allopurinol) ausgelöst wird. Es ist gekennzeichnet durch schmerzhafte Ulzerationen und Erosionen der Haut und Schleimhäute, begleitet von einer Blasenbildung und Ablösung des betroffenen Gewebes. Sind mehr als 30% der Hautoberfläche betroffen spricht man von einer toxisch epidermalen Nekrolyse (TEN). Die Therapie besteht im Absetzen der auslösenden Medikamente und einer Behandlung wie bei Verbrennungen.
Schädigung der Zellmembran
Zyklische Lipoproteine
Die Zytoplasmamembran ist der Angriffspunkt der zyklischen Lipoproteine. Der wichtigste Vertreter dieser Gruppe ist das Daptomycin. Daptomycin ist ein großes Molekül mit einem hydrophilen Peptidanteil (wasserliebend). Außerdem besitzt es einen lipophilen Anteil (fettliebend). Substanzen, die sowohl hydrophile als auch lipophile Anteile besitzen, werden auch als amphiphil bezeichnet. Die Phospholipid-Doppelschicht ist ebenfalls amphiphil. Daher kann sich Daptomycin in die Zellmembran einlagern und einen Ionenkanal bilden. Dies führt zu einer Depolarisation der Zelle und damit zu einer Protein-Dysfunktion und einer Hemmung der RNA- und DNA-Synthese.
TippFun Fact: Daptomycin wird durch Surfactant in den Lungen inaktiviert und kann daher nicht bei bakteriellen Infektionen der Lungen eingesetzt werden.

| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
Zyklische Lipopeptide Bakterizid | ||
| Daptomycin | Nur grampositive |
Reserveantibiotikum |
Nebenwirkungen
- Myopathie → Bei Therapiebeginn CK-Kontrolle
- Erhöhte Leberwerte
- Kopfschmerzen
- Gastrointestinale Nebenwirkungen
Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
Kationische Peptide/Polymyxine
Kationische Peptide sind kurze Sequenzen von Aminosäuren, die positiv geladen sind. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Antibiotika in ihrer Wirkungsweise, da sie nicht auf ein spezifisches Ziel abzielen, sondern die äußere Zellmembran von gramnegativen Erregern destabilisieren. Dadurch kommt es zur Lyse der Zelle und letztendlich zum Absterben des Erregers (bakterizid). Colistin wird auch vermehrt in der Veterinärmedizin eingesetzt, sodass bereits resistente Keime in Abwässern von Tierhaltungsbetrieben nachgewiesen werden konnten.
| Wirkstoff | Erregerspektrum | Spezifische Indikationen |
|---|---|---|
| Kationische Peptide/Polymyxine Bakterizid | ||
| Colistin | Nur gramnegative |
Nur topische Therapie (systemisch schlechte Verträglichkeit, schlechte Resorption bei oraler Gabe) |
Antibiotika-Lernkarten
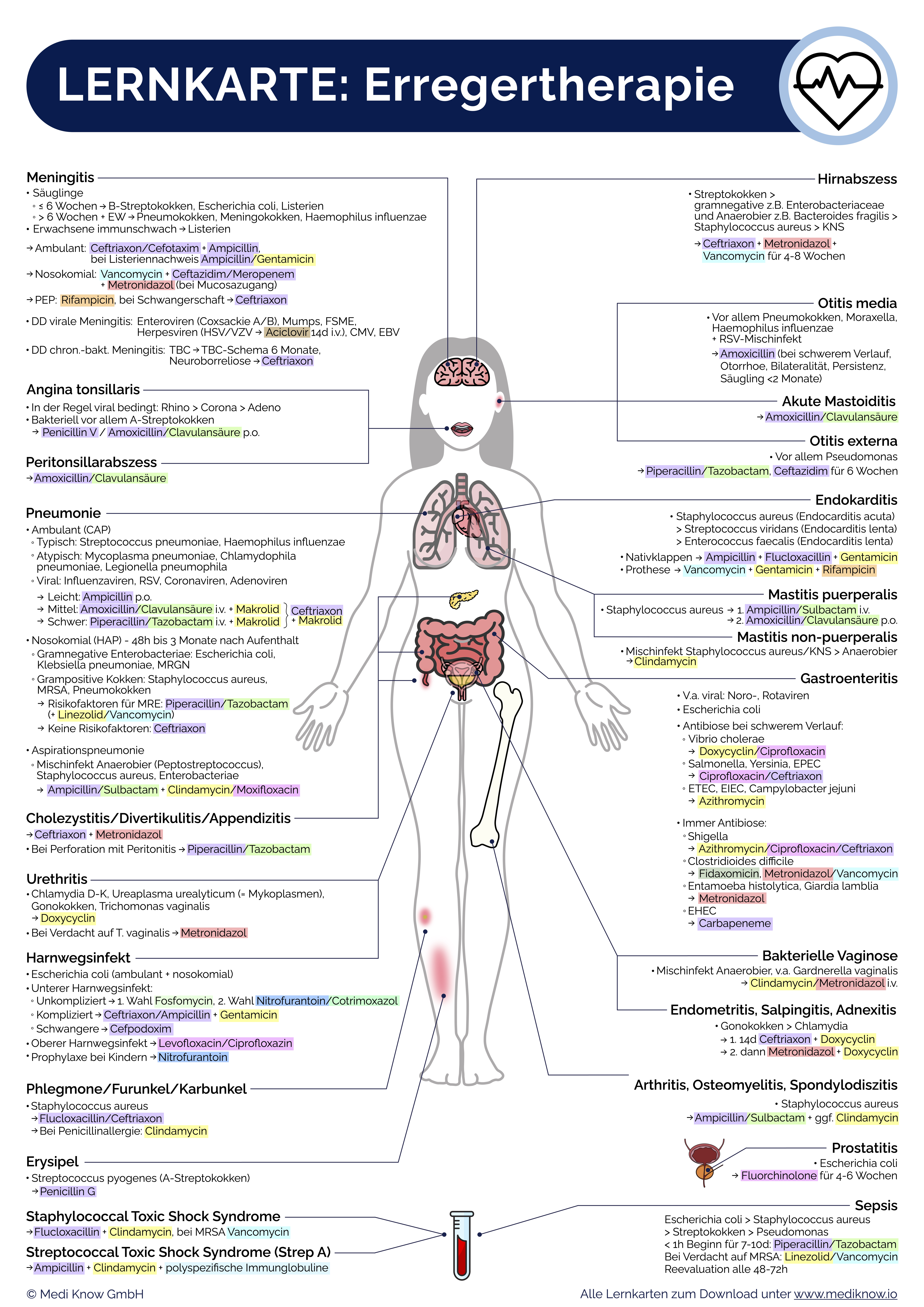
TippUnsere Lernkarten-Sammlung wächst täglich – mit dem Premium+AI+Skripte- oder Basic-Abo gibt es Zugriff auf alle Artikel mit Lernkarten inklusive Download. Jetzt im Shop freischalten und noch effizienter lernen 🚀
Lernkarte Erregertherapie : 🔗 Link zum Download

TippUnsere Lernkarten-Sammlung wächst täglich – mit dem Premium+AI+Skripte- oder Basic-Abo gibt es Zugriff auf alle Artikel mit Lernkarten inklusive Download. Jetzt im Shop freischalten und noch effizienter lernen 🚀
Antibiotika-Lernkarten : 🔗 Link zum Download
Video
Quellen
- Freissmuth et al.: Pharmakologie und Toxikologie. Springer 2012, ISBN: 978-3-642-12353-5.
- Karow, Lang-Roth: Allgemeine und Spezielle Pharmakologie und Toxikologie 2012
- Lüllmann et al.: Pharmakologie und Toxikologie. 15. Auflage Thieme 2002, ISBN: 3-133-68515-5
- Wehling: Klinische Pharmakologie. 2. Auflage Thieme 2011, ISBN: 978-3-131-60282-4



